Clark, Wehler etc.: die Apologie der deutschen Rolle bei Kriegsbeginn 1914 feiert im neu vereinten Deutschland “fröhliche Urständ”.
Als wenn die Phase der Kritik nach dem 2. Weltkrieg (zwar zunächst 1950-55 schnell abgebrochen, da durch den Ost-West-Konflikt überholt), 1961 neu aufgenommen, nun endlich aus dem Bewußtsein der Deutschen zu verschwinden habe. Denn nun geht es ja wieder um weltumspannende Aktivitäten und Machtausübung.
Wenn das nun nicht ein drittes Mal schiefgeht…
Vor 100 Jahren: Die Welt im Krieg.
Der Erste Weltkrieg. Menschen verloren ihr Leben, ihre Angehörigen, ihre Heimat. Eine Lawine, die ‑ losgetreten ‑ unaufhaltsam durch Europa und schließlich die Welt rollte und, im Grunde bis heute, für Leid, Armut und Trauer sorgte. Doch wie konnte es dazu kommen? Bernd F. Schulte analysiert in:
Deutsche Policy of Pretention. Der Abstieg eines Kriegerstaates 1871‑1914, Norderstedt 2009“
Hintergründe und Entwicklungen, die zu diesem tiefsten Einschnitt der neueren Geschichte führten, und vermittelt neue Erkenntnisse zu Ablauf wie auslösenden Ereignissen.
November/Dezember 1912: dunkle Wolken ziehen über dem Balkan auf. Es werden in Springe und Berlin Krisenkonferenzen zur politischen Lage Europas abgehalten. Es geht um Krieg oder Nichtkrieg. Politiker und Militärs ringen miteinander und schließlich sind Reichskanzler und Generalstabschef einig. Im Jagdschloß von Springe wird die Parole ausgegeben: Krieg bei nächster Gelegenheit. Die größte Heeresverstärkung im Kaiserreich ist beschlossene Sache. Der große Krieg steht unmittelbar bevor.
Am 28. Juli 1914 erklärt Österreich Serbien den Krieg und damit befinden sich Deutschland auf österreichischer Seite und Russland auf serbischer Seite im Kriegszustand. Es folgen die deutsche Kriegserklärung an Frankreich und die Englands an das Deutsche Reich. Damit befindet sich am 3. August Europa im Krieg. Als dafür verursachend anzusehen sind die diplomatisch‑politischen, sozialgeschichtlichen und vor allem die engen militär‑ und rüstungspolitischen Interdependenzen innerhalb der deutschen Führungselite vor 1914.
Das Forschungsproblem rund um die Frage nach der Kriegsschuld von 1914 – und wie diese auf die beteiligten Mächte zu verteilen ist – steht 100 Jahre danach im Focus des allgemeinen Interesses. Die brisante politische und strategische Situation von damals gewinnt neue Aktualität; auch über den Rahmen rein wissenschaftlicher Diskussion hinaus. Schulte zeigt überdies, wie die gravierenden strukturellen Defekte im Staatsaufbau des Deutschen Reichs, und darüber hinaus in dessen Armee, schließlich zur Niederlage, und damit dem Verlust der seit 1871 gewonnenen Position als europäischer, halbhegemonialer Macht führten.
Im August 2014 wird sich der Ausbruch des ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal jähren. Alles deutet darauf hin, dass sich wissenschaftliche Kontroverse und Gedenkfeiern hart im Raume stoßen werden. Um so mehr ist es unverzichtbar, die Beschäftigung mit dem historischen Phänomen „Erster Weltkrieg“ weiter zu kultivieren, denn dessen politische Lehren sind bis heute noch nicht gezogen.
Im Rahmen der Hamburger Studien zu Geschichte und Zeitgeschehen hat Bernd F. Schulte darüber hinaus ein Sammelwerk verfasst, das einen detaillierten Bogen über 25 Jahre Weltkriegsforschung spannt. Der etablierte Historiker, Publizist, Film‑ und Fernsehproduzent hat als Dozent an Hamburger Hochschulen unter anderem wichtige Beiträge zur deutschen Militärgeschichte, diplomatisch‑ politischen Entwicklung auf dem Balkan, zur Wissenschaftsgeschichte der 50er und 60er Jahre sowie zu den deutsch‑deutschen Beziehungen zwischen 1970 und 1990 geleistet.
Bernd F. Schulte: Deutsche Policy of Pretention: Der Abstieg eines Kriegerstaates 1871‑ 1914. Hamburger Studien zu Geschichte und Zeitgeschehen, Reihe II, Bd. 1, Norderstedt (Dr. Schulte) 2009. 404 S., 22,80 €, ISBN 978‑3‑8370‑2261‑3


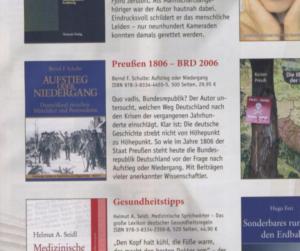
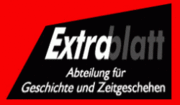



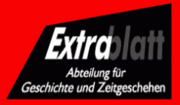

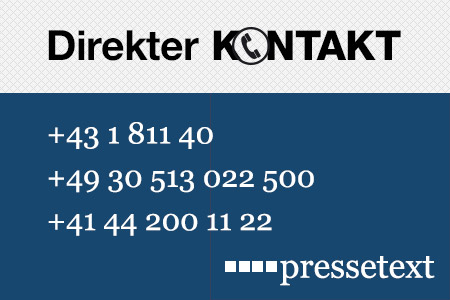


























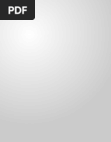

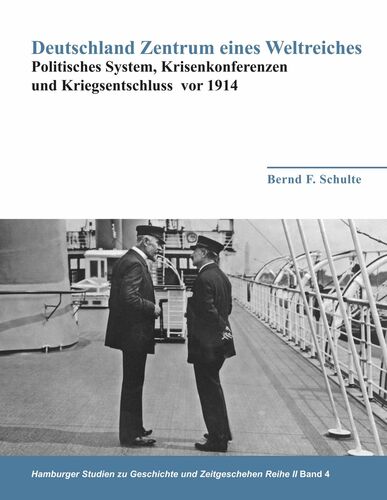



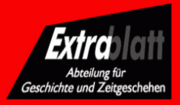

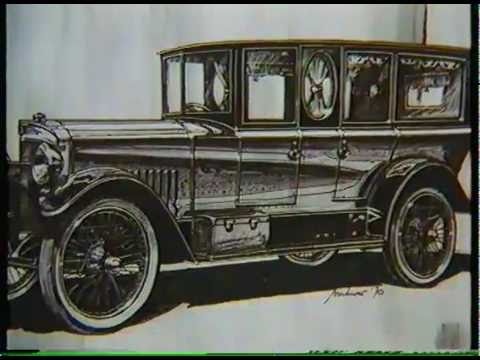





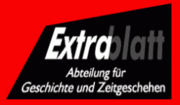






















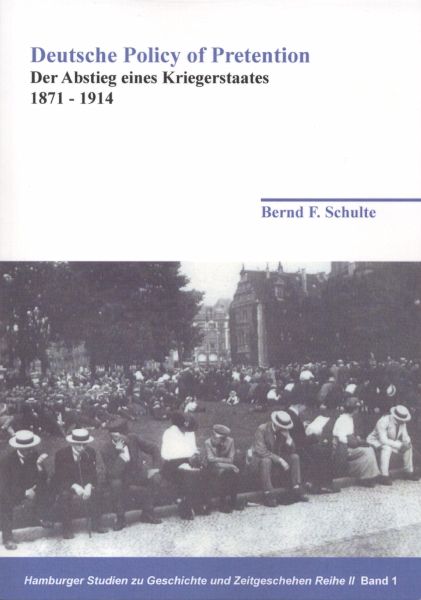


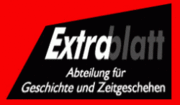






Ein etwas „kautziger“ Zwischenruf.
Werner Hahlweg, auf dem einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte in Deutschland, als Clausewitzspezialist mit der 16. Aufl. des „Vom Kriege“ „ff.“ immer wieder hervorgetreten, unternahm es 1982 auf meinen in der „Europäischen Wehrkunde“ (Streitkräfte im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Die deutsche Armee 1900 bis 1914, Nr. 5, 32. Jg., Mai 1983, S. 239-245)“ nur zur Hälfte abgedruckten Aufsatz zur Kaiserreichsarmee, schon vorbereitend (Wehrwissenschaftliche Rundschau, 6/82, S. 203f.) zu „antworten“.
Der Riss lief nämlich damals mitten durch die Redaktion der äußerst konservativen Militärzeitschrift. Das war nicht verwunderlich, denn diese ersetzte die bekannte „Wehrwissenschaftliche Rundschau“ des Kalten Krieges. Dass die Vertreter der Clauswitz-Gesellschaft über die Ankündigung nicht erfreut waren, mein Aufsatz werde nach den taktischen, technischen und strukturellen Schwächen der deutschen Armee von 1914 auch noch deren „Bürgerkriegsfunktion“ als Haupthindernis für Modernität herausstellen, genügte dem Herausgeber Herrn Ewald Heinrich von Kleist, dem Chefredakteur, Generalleutnant a.D. Carl-Gero von Ilsemann, die Freundschaft zu kündigen. Dieser sagte mir damals, das sei ihm alles zu ärgerlich und er werde den Posten des (ehrenamtlichen) Chefredaktors aufgeben.
Die Urängste dieser Hahlwegschen Generation von deutschen Historikern, vor dem Thema Erster Weltkrieg, ist mit Händen zu greifen und es stimmt schon nachdenklich, wenn diese Haltung offensichtlich derart tief in die Bundeswehr hineinwirkte. So kann das Heute der Anschauungen in der deutschen Armee der Gegenwart nur aus dem Gestern der 50iger bis 80iger/90iger Jahre verstanden werden. Und dann wird Vieles klar…
Bernd F. Schulte